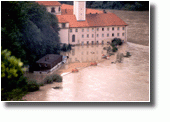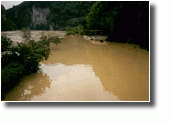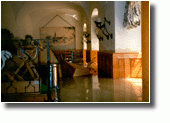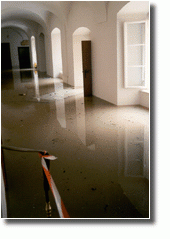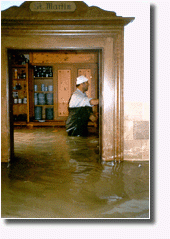Die Ausstellung dauert vom 20. Juli 2002 — 2003
Aussteller
Alois Achatz
Leporello (Ausstellungssaal)
Ludwig Bäuml
Schrein (Frauenbergkapelle)
Alfred Böschl
Hommage an M.B. (vor der Asamkirche)
Klaus Caspers
TURM (auf dem Frauenberg)
Peter Dorn
Lichtspur (im rechten Apsisbereich der Asamkirche, nur am 19. Juli 2002)
Gautam, Lajos Golan (Bildhauergruppe lamoer)
Die Säule der Tugenden (vor dem Eingangstor des Klosterhofes)
Reiner John
Raumtext (überall auf der Klosteranlage)
Herbert Karl
Donau-Durchblick (Auf dem Weg vom Kloster Weltenburg bis zur Schiffsanlegestelle)
Anton Kirchmair
Ohne Titel (Frauenbergkapelle)
Merve
Festtagsgewand für Maria 2001, genäht im Steinbruch, Gefässe und Pflugschar 2002 (Frauenbergkapelle)
Anja Müller
“You can go to a beautiful temple…” (nach dem Aufgang zum Frauenberg)
Ruth Oswald
Pollenbrett (Frauenbergkapelle)
Stefan Pietryga
der blaue Reiter — eine Szene in Weltenburg (Klostergarten)
Heiner Riepl
ora et labora (rechts neben dem Eingangstor)
Christian Schnurer
Die Pforte zur Seligkeit (Ausstellungssaal)
Jürgen Winderl
Granulat und Gran Tourismo (Klosterhof, Ausstellungssaal)
Ziegler, Viebig, Sakowski, Lunz = Krunk
Bildende Kunst und Musik der Künstlergruppe Krunk (INTERAKTIONS-PROJEKT, Klosterhof, nur am 19. Juli 2002)
Veranstalter
Kloster Weltenburg
Abt Thomas Freihart OSB
Idee, Konzept und Organisation
Alfred Böschl
Betreuung und Gastgeber
Anton Röhrl
Wirt der Klosterschänke Weltenburg
Sponsoren
BMW AG, Werk Regensburg
Verein Ausstellungshaus für Christliche Kunst E.V., München
Ein großformatiger Katalog informiert ausführlich über die Künstler und ihre Werke (in S/W‑Fotos). Er ist im Klosterladen in zwei Ausführungen erhältlich: mit bzw. ohne 2 Audio-CDs mit Musik der Band Krunk und der Klangkollage “Kieselsteine” von Jürgen Winderl. Der Katalog kostet mit den beiden CDs 15,- Euro, ohne CDs 11,- Euro. Er kann auch durch Einsendung von 18,- Euro bzw. 14,- Euro (inkl. 3,- Euro Porto/Verpackung) in bar oder Scheck per Post bezogen werden:
Benediktinerabtei Weltenburg
Klosterladen
Asamstraße 32
93309 Kelheim
Bitte vergessen Sie nicht, Ihre genaue Anschrift anzugeben.


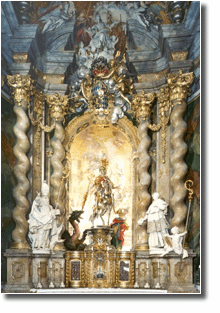 Fast drei Jahre war der Blick auf den berühmten Hochaltar der Klosterkirche durch ein Gerüst verdeckt. In der ersten Etappe wurden die lebensgroßen Hauptfiguren, der hl. Georg auf dem Pferd, der den Drachen tötet, die Königstochter, sowie die hll. Martin und Maurus restauriert.
Fast drei Jahre war der Blick auf den berühmten Hochaltar der Klosterkirche durch ein Gerüst verdeckt. In der ersten Etappe wurden die lebensgroßen Hauptfiguren, der hl. Georg auf dem Pferd, der den Drachen tötet, die Königstochter, sowie die hll. Martin und Maurus restauriert. 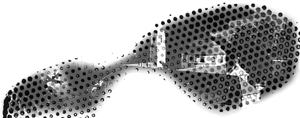 Die Ausstellung dauerte vom 29. Juli — 3. September 2000.
Die Ausstellung dauerte vom 29. Juli — 3. September 2000.